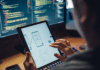Künstliche Intelligenz (KI) ist im Jahr 2025 allgegenwärtig – von Sprachassistenten auf dem Smartphone bis hin zu intelligenten Systemen in Fabriken und Behörden. Wer das Thema ignoriert, wird mittelfristig abgehängt.
Eine aktuelle Studie von Telefónica zeigt: 70 % der Smartphone-Nutzer:innen verwenden bereits mindestens eine KI-Anwendung, und jeder Zweite möchte KI künftig noch intensiver nutzen. Selbst bisher Zurückhaltende sind neugierig: Über ein Drittel jener, die bislang auf die Verwendung von KI verzichtet haben, will die Technologie in den nächsten Monaten zumindest mal ausprobieren.
All das macht deutlich, dass spätestens jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sich mit KI zu befassen. Ob Privatperson, Unternehmen oder öffentliche Verwaltung – alle stehen vor der Aufgabe, die Chancen der KI zu nutzen und damit einhergehende Herausforderungen aktiv anzugehen.
KI im Alltag: Chancen und Herausforderungen für Privatpersonen
KI-Technologien sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Laut der bereits erwähnten Telefónica-Verbraucherstudie nutzen 86 % der 16–29-Jährigen KI auf ihrem Smartphone; selbst in der Generation 60–69 tut dies bereits jeder Zweite. Sie dient dabei vielen als praktischer Alltagshelfer: 70 % der Befragten verwenden KI-Apps für Recherchen – und über die Hälfte gibt an, mit Chatbots oder KI-Generatoren Aufgaben effizienter zu erledigen. Das gilt vor allem für lästige Routinearbeiten. Weitere beliebte Einsatzbereiche beinhalten Echtzeit-Übersetzungen sowie Gesundheits- und Bildungs-Apps.
Den großen Chancen stehen jedoch Herausforderungen gegenüber. Viele Menschen fühlen sich unsicher im Umgang mit KI. 61 % der Deutschen geben an, dass ihnen Wissen und Informationen über KI fehlen, und 78 % fordern mehr Aufklärung über die Risiken dieser Technologie. Diese Bedenken sind verständlich: KI-Systeme treffen Entscheidungen oft intransparent, können Vorurteile aus Daten übernehmen und Datenschutz-Fragen aufwerfen. Entsprechend wichtig ist es, Bürgerinnen und Bürgern KI-Kompetenzen zu vermitteln – von der Fähigkeit, KI-Ergebnisse kritisch zu hinterfragen, bis zum Verständnis, wie persönliche Daten durch KI genutzt werden.
Hier stehen vor allem Bildungseinrichtungen und die Medien in der Pflicht, digitale Bildung und KI-Grundwissen breiter verfügbar zu machen. Nur so kann jeder Einzelne lernen, KI verantwortungsvoll und souverän zu nutzen – für sich selbst und im gesellschaftlichen Miteinander.
Unternehmen und KI: Innovationstreiber mit Weiterbildungsbedarf
Für Unternehmen ist KI längst mehr als ein Technologietrend – sie wird zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. In der deutschen Industrie setzen schon 42 % der Unternehmen KI in der Produktion ein, weitere 35 % planen dies laut des Branchenverband Bitkom e.V. kurzfristig.
Quer durch alle Branchen automatisieren Firmen Abläufe, optimieren Produktion, Logistik sowie Wartung – und entwickeln dank KI sogar neue Geschäftsmodelle. 8 von 10 Industrieunternehmen (82 %) sind sich inzwischen einig, dass KI künftig entscheidend für ihre Wettbewerbsfähigkeit sein wird. Anwendungsszenarien reichen von Predictive Maintenance (KI-gestützte Vorhersage von Maschinenausfällen) über Chatbots im Kundenservice bis hin zu datengetriebener Produktentwicklung.
Die Chancen sind enorm: KI kann die Produktivität steigern, Kosten senken und Raum für Innovation schaffen. Studien beziffern das Potenzial auf gewaltige Produktivitätszuwächse – weltweit wird mit mehreren Billionen Dollar an zusätzlichem Wirtschaftswachstum durch KI gerechnet. Kein Wunder also, dass kaum ein Unternehmen den „KI-Zug“ verpassen will. Gleichzeitig herrscht in vielen Betrieben eine gewisse Dringlichkeit, jetzt aktiv zu werden. Knapp die Hälfte (46 %) der Industrieunternehmen fürchtet, die KI-Revolution zu verschlafen, falls sie nicht entschlossen investieren.
Allerdings gibt es noch einige Hürden zu überwinden: Laut einer Umfrage von Stifterverband und McKinsey sehen zwar 86 % der Führungskräfte noch viel ungenutztes KI-Potenzial im eigenen Unternehmen, doch 79 % beklagen fehlende KI-Kompetenzen bei ihren Mitarbeitenden. Der Fachkräftemangel im KI-Bereich und Wissenslücken im Umgang mit neuen Tools bremsen die Umsetzung. Derweil wird in entsprechende Weiterbildungsangebote noch zu zögerlich investiert.
Und dennoch tut sich was: Universitäten und Berufsschulen nehmen KI-Themen immer häufiger in ihre Studiengänge und Lehrangebote auf. Hinzukommt die regionale KI-Förderung, wie beispielsweise das KI-Innovation Lab Karlsruhe. Das vom CyberForum e.V. getragene Lab unterstützt mittelständische Unternehmen dabei, KI-Potenziale zu erkennen und Lösungen praktisch umzusetzen (Hier geht’s zum KI-Innovation Lab.) .
Derartige Initiativen helfen, Wissen aufzubauen und Hürden bei der KI-Einführung zu überwinden.
Öffentliche Verwaltung: Mit KI zum digitalen Staat
Neben Privatpersonen und Unternehmen stehen auch Behörden und Verwaltungen 2025 vor der Aufgabe, KI für sich zu nutzen. Denn die Bürgerinnen und Bürger erwarten vom Staat effiziente Dienstleistungen, transparente Prozesse und schnellere Bearbeitungszeiten. International ist der Trend klar erkennbar: 67 % der OECD-Länder setzen KI ein, um Gestaltung und Bereitstellung öffentlicher Services zu verbessern. Regierungen nutzen Künstliche Intelligenz, um bessere Entscheidungen zu treffen und den Kontakt mit Bürger:innen zu erleichtern.
In Deutschland laufen ebenfalls vielfältige Projekte: Einige Städte setzen Chatbot-Assistenten ein, die Bürgeranfragen rund um die Uhr beantworten. In Rathäusern werden Testläufe unternommen, um Anträge automatisiert zu prüfen oder Behördendokumente per KI zu klassifizieren, sodass Sachbearbeiter entlastet werden. In der Verkehrsplanung hilft KI, Verkehrsströme zu analysieren und Ampelschaltungen dynamisch anzupassen. Und in der Verwaltung großer Datenmengen – etwa beim Finanzamt oder in der Sozialversicherung – kann KI Muster erkennen und so zur Betrugsprävention beitragen.
Die Chancen für die öffentliche Hand sind offensichtlich: KI kann angesichts des demografischen Wandels helfen, Personallücken zu schließen, indem Routineaufgaben automatisiert werden. Die Bürgerinnen und Bürger würden von schnelleren Antworten und weniger Bürokratie profitieren. Zudem eröffnen sich neue Anwendungsfelder wie Smart Cities, in denen Verkehr, Energie und Umwelt mit KI effizienter gesteuert werden.
Wie in kaum einem anderen Bereich muss in der Verwaltung allerdings auf ethische Standards und den Datenschutz geachtet werden, da hier mit sensiblen Bürgerdaten gearbeitet wird. Aus diesem Grund ist die Umsetzung hier besonders aufwändig und langwierig.
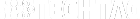

![Rückblick 2025: KI, digitale Empathie und smarte Systeme [Teil 1] Jahresrückblick 2025](https://techtag.de/wp-content/uploads/2016/12/Jahresrueckblick-Digitalwirtschaft-Teil-1-218x150.png)



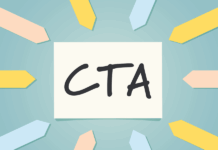








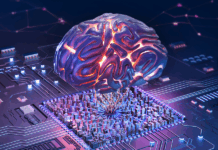

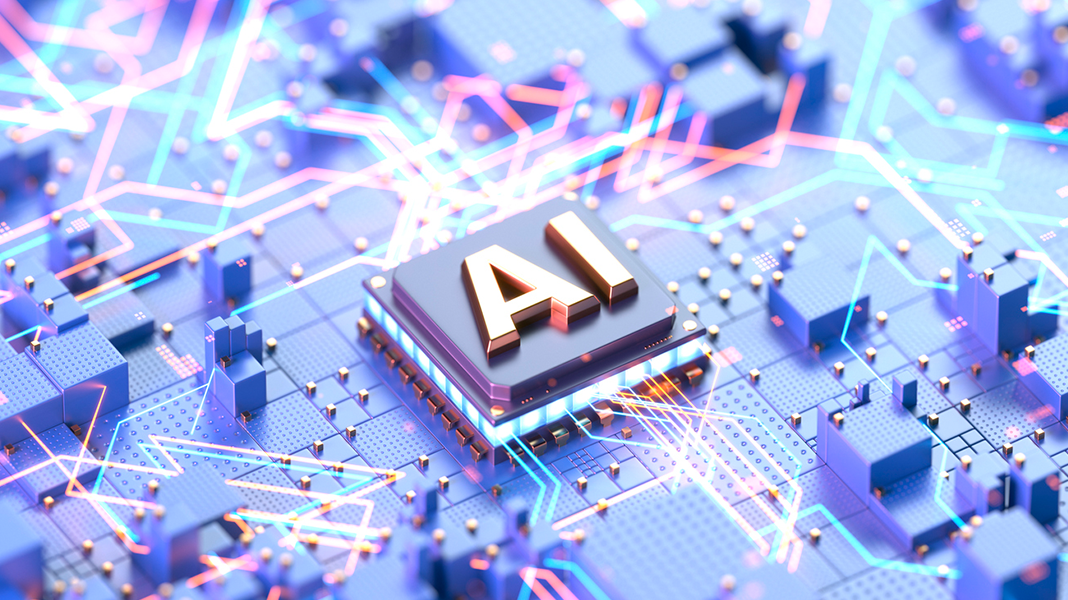

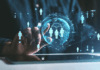
![Rückblick 2025: KI, digitale Empathie und smarte Systeme [Teil 1] Jahresrückblick 2025](https://techtag.de/wp-content/uploads/2016/12/Jahresrueckblick-Digitalwirtschaft-Teil-1-100x70.png)