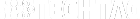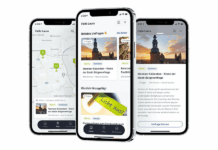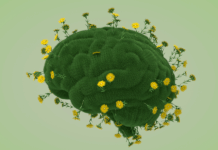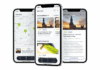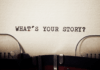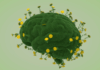Mal ehrlich: Wie oft buchen wir Trainings – ohne wirklich zu wissen, was wir damit entwickeln wollen?
Personalentwicklung gilt als Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit. Doch in der Praxis passiert oft das Gegenteil: Statt systematisch an Kompetenzen zu arbeiten, reagieren wir. Wird ein Ziel verfehlt, herrscht Unzufriedenheit im Team oder steht eine Veränderung an, folgt der schnelle Griff ins Maßnahmenregal – ein Kommunikationstraining hier, ein Resilienz-Workshop dort, vielleicht noch ein Zeitmanagement-Seminar. Doch kaum jemand stellt vorher die entscheidende Frage: Was genau fehlt hier eigentlich?
Wer Personalentwicklung wirksam gestalten will, muss tiefer schauen. Denn schlechte Ergebnisse sind nicht das Problem – sie sind das Symptom. Dahinter steckt immer Verhalten. Und Verhalten wiederum ist Ausdruck von Kompetenzen. Genau hier liegt der eigentliche Hebel für Entwicklung. Dieses Prinzip hat Dana Nouzovska – Beraterin, Coach, Trainerin und Diagnostikerin – im Workshop „Personal entwickeln im (Führungs-)Alltag“ der Reihe „Next Level HR: Strategisches Recruiting und Personalentwicklung 2025“ (Modul 4) vermittelt.
Entwicklung beginnt mit dem Bedarf – nicht mit dem Katalog
Wer Kompetenzen gezielt entwickeln will, muss zuerst wissen, welches Werkzeug überhaupt gebraucht wird. Das klingt simpel – ist aber ein entscheidender Schritt, der im Alltag oft übersprungen wird.
Eine systematische Bedarfserhebung ist wie eine gründliche Baustellenanalyse, bevor der erste Handgriff gemacht wird. Und sie lohnt sich mehrfach:
- Gezielte Maßnahmen statt Gießkanne: Nur wenn klar ist, was entwickelt werden soll, kann Weiterbildung passgenau geplant werden – und spart Zeit, Geld und Frust.
- Strategische Kompetenzsteuerung: Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Wer weiß, welche Kompetenzen im Unternehmen fehlen oder schwach ausgeprägt sind, kann vorausschauend handeln – und zukünftige Herausforderungen meistern.
- Vergleichbarkeit und Transparenz: Objektiv erfassbarer Entwicklungsbedarf schafft eine faire Grundlage für Entscheidungen – sei es bei Beförderungen, Projektbesetzungen oder Nachfolgeplanung.
- Mitarbeitende einbinden und motivieren: Wenn Menschen wissen, wo sie stehen und was sie entwickeln können, entstehen Klarheit, Dialog und Motivation. Entwicklung wird zu etwas, das mit den Mitarbeitenden geschieht – nicht über ihre Köpfe hinweg.
Ergebnisse sind Symptome – Kompetenzen sind der Hebel
Stellen wir uns vor: Eine Mitarbeiterin verfehlt ihre Ziele. Warum? Liegt es an fehlender Priorisierung? An mangelhafter Selbstorganisation? Oder daran, dass sie Aufgaben nicht klar genug kommuniziert? Unterschiedliche Ursachen – und jede davon verlangt eine andere Entwicklungsmaßnahme.
Das zeigt: Wer nur aufs Ergebnis blickt, bleibt an der Oberfläche. Entscheidend ist der Blick auf das Verhalten, das zu diesem Ergebnis geführt hat. Und noch eine Ebene tiefer: Auf die Kompetenz, die dieses Verhalten ermöglicht – oder eben verhindert.
- Ergebnis: Das Ziel wurde nicht erreicht.
- Verhalten: Aufgaben wurden nicht priorisiert oder nicht klar kommuniziert.
- Kompetenz: Selbstorganisation, Kommunikationsfähigkeit oder Entscheidungsstärke.
Nur wenn klar ist, welche Kompetenz tatsächlich fehlt oder gestärkt werden muss, kann Personalentwicklung gezielt greifen.
Intuition reicht nicht – Entwicklung braucht Struktur
In der Praxis wird Entwicklung oft auf Basis von Beobachtungen und subjektiven Eindrücken gesteuert. Das klingt plausibel, ist aber riskant. Denn was wie ein Defizit wirkt, kann auch einfach ein Unterschied im Stil sein. Wer jemanden als „chaotisch“ wahrnimmt, reagiert vielleicht auf einen flexiblen Arbeitsstil, der nicht dem eigenen entspricht. Was als „unklare Kommunikation“ erscheint, könnte Unsicherheit sein – oder eine andere Erwartung an Präzision.
Hier helfen Kompetenzmodelle. Sie schaffen Struktur und Sprache für das, was oft vage bleibt. Statt diffusem Eindruck gibt es konkrete Begriffe und Verhaltensbeschreibungen:
- Ist „unklare Kommunikation“ eine Frage der Sprachpräzision (kognitive Kompetenz)?
- Geht es um fehlende Empathie (soziale Kompetenz)?
- Oder zeigt sich dahinter Unsicherheit (persönliche Kompetenz)?
Kompetenzmodelle übersetzen Verhalten in beobachtbare Kategorien – und machen Entwicklung dadurch gezielt steuerbar. Ohne diese Struktur bleibt Personalentwicklung ein Glücksspiel.
Modelle müssen helfen – nicht perfekt sein
Ein gutes Kompetenzmodell ist kein starres Regelwerk, sondern ein praxistaugliches Werkzeug. Es muss nicht perfekt sein – aber es muss helfen. Idealerweise ist es schlank, verständlich und konkret.
Die Grundstruktur ist oft ähnlich:

- Fach- und Methodenkompetenzen: Fähigkeiten, um fachliche Aufgaben effizient und strukturiert zu lösen.
Beispiele: Analytisches Denken, Problemlösung, Fachwissen, Anwendung von Methoden.
- Personale Kompetenzen: Innere Fähigkeiten zur Selbststeuerung und Weiterentwicklung.
Beispiele: Belastbarkeit, Lernbereitschaft, Selbstreflexion, Eigenverantwortung.
- Soziale Kompetenzen: Fähigkeiten im Umgang mit anderen Menschen.
Beispiele: Kommunikation, Teamfähigkeit, Konfliktverhalten, Empathie.
- Handlungskompetenz: Die Fähigkeit, Wissen und Können zielgerichtet in die Praxis umzusetzen.
Beispiele: Initiative, Zielorientierung, Entscheidungsfreude, Umsetzungsstärke.
Wichtig ist auch der Bewertungsmaßstab. Statt rein relativer Einschätzungen („Für eine Junior-Kraft ist das ausreichend…“) bietet ein absoluter Maßstab oft mehr Orientierung. Eine „5 von 5“ in Kommunikation bedeutet dann dasselbe – unabhängig davon, ob es sich um Azubis oder Führungskräfte handelt. Das schafft Transparenz, Vergleichbarkeit und klare Entwicklungspfade. Natürlich gibt es auch Kontexte – etwa sehr heterogene Zielgruppen –, in denen differenzierte, gruppenspezifische Maßstäbe sinnvoller sind. Entscheidend ist, das passende Modell bewusst zu wählen.
Ob wissenschaftlich fundiert oder aus der Praxis abgeleitet – entscheidend ist nicht der Ursprung des Modells, sondern seine Anwendbarkeit. Es muss verständlich sein, trennscharf formuliert und über den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus hinweg nutzbar.
Und vor allem: Es muss genutzt werden. Lieber ein einfaches Modell, das lebt, als ein perfektes, das in der Schublade liegt.
Fazit: Entwicklung braucht Klarheit – nicht Kataloge
Gute Personalentwicklung beginnt nicht mit der Frage: „Welches Training buchen wir?“ Sondern mit der Frage: „Welche Kompetenz wollen wir entwickeln – und warum?“
Kompetenzmodelle helfen, Verhalten sichtbar zu machen, Potenziale zu erkennen und Entwicklung planbar zu gestalten. Sie bringen Struktur ins Bauchgefühl und schaffen eine gemeinsame Sprache für Entwicklung – klar, nachvollziehbar und wirksam.
Branchenzentriert qualifizieren
Im Rahmen des Aufrufs „Branchenzentriert qualifizieren – Zukunft sichern“ wird durch das ESF-Plus Projekt „Branchen-Quali-Digital“ die IKT-Branche in Baden-Württemberg durch branchenzentrierte Qualifizierung zukunftsfähig aufgestellt, damit sie Treiber von Innovation und gesamtwirtschaftlichem Wachstum in nahezu allen anderen Wirtschaftsbereichen bleibt. Kofinanziert vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Landes Baden-Württemberg.