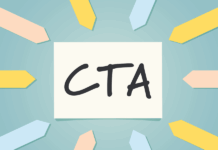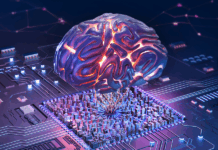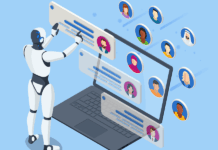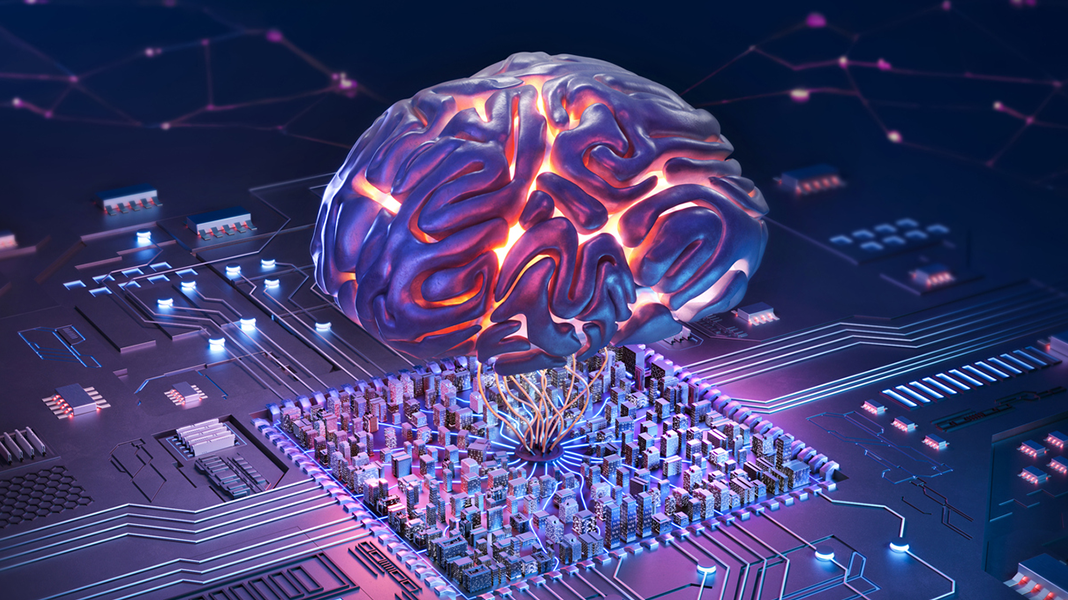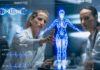Das Massachusetts Institute of Technology (MIT) gehört zu den renommiertesten Forschungsuniversitäten der Welt. Sein Media Lab untersucht, wie Technologie unser Verhalten und Denken beeinflusst. Eine aktuelle Studie zeigt nun: Die Nutzung von KI-Tools wie ChatGPT verändert nicht nur, wie wir schreiben, sondern auch, wie unser Gehirn arbeitet – mit überraschend ernüchternden Ergebnissen.
Die Studie im Überblick
Über vier Monate begleiteten die Forschenden 54 Studierende beim Verfassen von Essays. Die Teilnehmenden wurden in drei Gruppen eingeteilt: Die erste nutzte ChatGPT (LLM-Gruppe), die zweite arbeitete mit klassischen Suchmaschinen (Search-Gruppe), die dritte schrieb komplett ohne digitale Hilfsmittel (Brain-only-Gruppe). Parallel dazu wurden EEG-Messungen durchgeführt und Interviews ausgewertet.
Die Ergebnisse:
- Die Gruppe, die mit ChatGPT arbeitete, zeigte durchgängig die geringste Gehirnaktivität.
- Im Vergleich: Brain-only-Schreibende zeigten die größte kognitive Vernetzung, die Such-Gruppe lag dazwischen.
- In den Interviews zeigte sich: Die LLM-Gruppe konnte sich kaum an ihre Essays erinnern und empfand wenig „Ownership“ für die eigenen Texte.
Noch beunruhigender sind die langfristigen Effekte. Wer über Wochen hinweg mit KI schrieb und dann wieder ohne Hilfsmittel arbeiten sollte, zeigte eine deutlich reduzierte kognitive Leistung. Das Gehirn hatte sich an die Abkürzung gewöhnt – eine Art „kognitive Schuldenbildung“. Die Studie mahnt daher zur Achtsamkeit: KI kann uns unterstützen, aber sie darf nicht unsere Fähigkeit zum Denken, Erinnern und kritischen Reflektieren untergraben.
Gerade weil KI unser Denken beeinflusst, ist es entscheidend, ihre Funktionsweise zu verstehen. Wer die Mechanismen hinter Sprachmodellen kennt, kann ihre Stärken nutzen, ohne blind zu vertrauen. KI-Kompetenz bedeutet nicht nur, Tools bedienen zu können, sondern auch kritisch zu hinterfragen, wie Ergebnisse entstehen, welche Daten dahinterstehen und wo Risiken liegen. Nur so bleiben wir handlungsfähig – als Lernende, Lehrende und Führungskräfte – und gestalten den Einsatz von KI aktiv, statt uns von ihr steuern zu lassen.
Was können wir dagegen tun? – 5 durchdachte Strategien
Die Forschenden schlagen fünf Strategien vor:

- Aktive Reflexionsphasen einbauen
Bevor du ChatGPT nutzt, nimm dir 3–5 Minuten für ein kurzes Brainstorming: Schreibe stichpunktartig deine eigenen Ideen oder zeichne eine Mindmap. Beispiel: Du sollst einen Blogartikel über „Remote Work“ schreiben? Skizziere zuerst drei Hauptargumente aus deinem Kopf, bevor du die KI fragst.
- Dual-Modus üben: KI + Hirn
Nutze KI als Sparringspartner, nicht als Autor. Beispiel: Lass dir von ChatGPT eine Gliederung vorschlagen, aber ergänze sie mit eigenen Quellen oder Erfahrungen. Wenn die KI schreibt „Remote Work steigert Produktivität“, prüfe Studien dazu und füge deine eigene Perspektive hinzu.
- Gedächtnistraining durch Rekonstruktion
Nachdem du einen KI-gestützten Text fertig hast, schließe alle Tabs und versuche, die Kernaussagen aus dem Gedächtnis in eigenen Worten zu notieren. Beispiel: Du hast einen LinkedIn-Post mit KI erstellt? Formuliere ihn später ohne Vorlage neu – das stärkt dein Erinnerungsvermögen.
- Ownership durch Umarbeitung fördern
Bearbeite KI-generierte Texte so stark, dass sie deinen Stil widerspiegeln. Beispiel: Markiere in deinem Dokument farblich, was von dir stammt und was von der KI kommt. Ändere Satzbau, füge persönliche Beispiele ein, streiche generische Phrasen – so entsteht echte „kognitive Verbundenheit“.
- KI-freie Zonen schaffen
Plane bewusst Phasen ohne KI. Beispiel: In deinem Team könnt ihr einen „No-KI-Mittwoch“ einführen, an dem alle Texte, Konzepte oder Ideen ohne digitale Hilfsmittel entstehen. Oder setze dir selbst einen 30-Minuten-„Deep Thinking Sprint“, bevor du KI einsetzt.
Fazit
KI soll uns helfen – nicht entmündigen. Wer Bildung, Arbeit oder Führung gestaltet, steht jetzt vor einer zentralen Aufgabe: Regeln zu schaffen, die den klugen, bewussten Einsatz von KI fördern – ohne unsere Denkfähigkeit aufs Spiel zu setzen.
Quelle: https://arxiv.org/abs/2506.08872
Branchenzentriert qualifizieren
Im Rahmen des Aufrufs „Branchenzentriert qualifizieren – Zukunft sichern“ wird durch das ESF-Plus-Projekt „Branchen-Quali-Digital“ die IKT-Branche in Baden-Württemberg durch branchenzentrierte Qualifizierung zukunftsfähig aufgestellt. Ziel ist es, die Branche als Treiber von Innovation und gesamtwirtschaftlichem Wachstum in nahezu allen Wirtschaftsbereichen zu stärken. Kofinanziert vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Landes Baden-Württemberg.

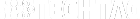


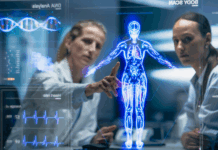
![1st Webflow Conferenz Get-Together Berlin Personen auf Bild bei Webflow-Konferenz (Copyright Veranstalter Christian Schmitt) Hinten links nach rechts * Hüseynagha Oji - Motion Design, Web Design * Andrej Belcikov - Web Designer und Developer * Tim-Alexander Schulz - Web Designer * Matthias Cordes - Web Designer * Eduard Bodak - Web Designer * Thomas Etscheidt - Webdesigner und Developer Mitte links nach rechts * Marvin Blach - Agentur Halbstark GmbH * Dennis Karg - Webflow Partner * Jonas Arleth - Web Designer * Nancy Drupka - Web Designer und Developer * Martin Georg - Web Developer Vorne links nach rechts * Tobias Gill - Flowabo Founder * Christian Schmitt - Webflow Global Leader und Certified Partner * Jan Niklas Hauck - Web Developer * Rebekka Liedtke - [Refokus] Lead Designerin](https://techtag.de/wp-content/uploads/2025/10/Bild-2-So-sehen-digitale-Pioniere-aus-218x150.jpeg)