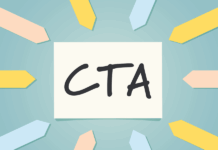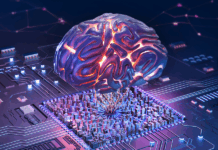Die Verwaltung in Deutschland steckt in vielen Bereichen noch immer im analogen Zeitalter fest. Das wird zunehmend auch für Unternehmen zum Problem.
Deutschland kämpft seit Jahren mit der Digitalisierung – und nirgendwo wird das so deutlich wie in der Verwaltung. Während Unternehmen längst auf Automatisierung, Künstliche Intelligenz und digitale Prozesse setzen, um effizienter zu arbeiten, halten Behörden an analogen Strukturen fest. Statt Arbeitsabläufe zu modernisieren, werden einfach neue Stellen geschaffen. Doch das Problem wird dadurch nur verlagert, nicht gelöst. Warum kommt die Digitalisierung der Verwaltung nicht voran? Welche Folgen hat das für Bürger:innen und Unternehmen? Und welche Lösungen gibt es? Wir haben genauer hingeschaut.
Verwaltung im digitalen Schneckentempo: Wo Deutschland im Vergleich steht
Ein Blick auf andere Länder zeigt, dass es auch anders geht. Während Deutschland laut dem EU-Digitalisierungsindex (DESI) 2022 nur auf Platz 18 von 27 Mitgliedstaaten liegt, sind Länder wie Estland, Dänemark oder Finnland längst Vorreiter in der digitalen Verwaltung. Besonders Estland gilt als Musterbeispiel: Dort können Bürger:innen nahezu jede Behördengang online erledigen – von der Steuererklärung bis zur Unternehmensgründung. In Deutschland hingegen müssen viele Anträge weiterhin per Post verschickt oder persönlich abgegeben werden.
Die Gründe dafür sind vielfältig. Auf der einen Seite leidet die Digitalisierung der Verwaltung unter den Folgen des Föderalismus, da nahezu jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht. Es ist nahezu unmöglich einheitliche Standards zu etablieren, was dazu führt, dass teilweise mehrere Lösungen für die gleichen Aufgaben entwickelt werden. Das kostet natürlich auch jede Menge Geld. Andererseits stehen auch die vergleichsweise hohen Datenschutzstandards der Digitalisierung im Wege, da bestimmte Prozesse schlichtweg deshalb nicht vereinfacht werden können, weil Behörde A keine Daten an Behörde B übermitteln darf.
So ist es auch wenig verwunderlich, dass es den Personalausweis mit Online-Funktion hierzulande inzwischen seit 15 Jahren gibt – dessen Möglichkeiten aber bis heute kaum genutzt werden, da entsprechende digitale Lösungen nicht flächendeckend umgesetzt werden. Wer in einer Stadt eine digitale Dienstleistung nutzen kann, muss sich in einer anderen Stadt womöglich wieder mit Papierformularen herumschlagen.
Mehr Stellen statt mehr Effizienz
Nicht anders sieht die Sache aus, wenn man sich den Umgang mit Personalmangel ansieht. Während Unternehmen neue Technologien nutzen, um Prozesse zu automatisieren und effizienter zu arbeiten, geht der öffentliche Dienst den entgegengesetzten Weg: Statt bestehende Arbeitsabläufe zu optimieren, werden immer neue Stellen geschaffen. Das führt zu einer Aufblähung des Verwaltungsapparats, ohne dass die grundlegenden Probleme gelöst werden.
Hinzu kommt, dass viele Ämter schlicht nicht das Personal haben, um digitale Projekte voranzutreiben. Eine Studie des Nationalen Normenkontrollrats zeigt, dass IT-Fachkräfte in der Verwaltung fehlen – nicht zuletzt aufgrund der häufig wenig konkurrenzfähigen Gehälter im Vergleich zur Privatwirtschaft. Die Folge: Projekte verlaufen im Sande, weil das digitale Know-how in den Behörden nicht ausreichend vorhanden ist.
Die Folgen für Wirtschaft und Bürger:innen
All das hat weitreichende Konsequenzen. Unternehmen verlieren durch bürokratische Prozesse wertvolle Zeit – und Zeit ist Geld. Laut einer Studie des ifo-Instituts kostet die Bürokratie deutsche Unternehmen jährlich bis zu 146 Milliarden Euro. Viele Abläufe, die mit digitalen Lösungen in Minuten erledigt wären, dauern Wochen.
Auch Bürger:innen bekommen den Stillstand der Verwaltung zu spüren. Lange Wartezeiten für Termine im Bürgeramt, umständliche Antragsverfahren und unnötige Papierberge sorgen für Frust. Während in anderen Ländern Gewerbeanmeldungen oder Steuererklärungen in wenigen Minuten online erledigt werden können, müssen sich Deutsche oft monatelang mit behördlichen Vorgängen herumschlagen.
Die Verwaltung selbst steht ebenfalls vor einem Problem: In den nächsten zehn Jahren gehen rund 500.000 der 1,65 Millionen Beschäftigten in den Ruhestand. Ohne digitale Lösungen wird es schwierig, diese Lücken zu füllen.
Wie die Digitalisierung gelingen kann
Es gibt durchaus Lichtblicke. Die elektronische Steuererklärung ELSTER zeigt, dass digitale Verwaltung funktionieren kann: Bereits 58 Prozent der Steuerpflichtigen geben ihre Steuererklärung online ab. Hamburg hat ebenfalls Fortschritte gemacht und ein digitales Bürgerportal eingeführt, das als Vorbild für andere Bundesländer dienen könnte.
Ein Schlüssel zur Lösung ist eine flächendeckende digitale Identität. Der elektronische Personalausweis mit Online-Funktion könnte viele Behördengänge ersetzen, wird aber bislang kaum genutzt. Eine stärkere Verbreitung könnte Bürger:innen Zeit sparen und die Verwaltung entlasten.
Die Verwaltung muss umdenken
Obwohl Beispiele wie das “Online-Finanzamt” ELSTER zeigen, dass digitale Verwaltung flächendeckend funktionieren kann, hat Deutschland diesbezüglich enormen Nachholbedarf.
Andere Länder zeigen bereits seit Jahrzehnten, dass es besser geht. Deutschland muss nun entschlossen handeln: mit klaren Verantwortlichkeiten, einheitlichen digitalen Strukturen und einer Verwaltung, die sich als Dienstleister für Bürger:innen und Unternehmen versteht. Nur so kann die Digitalisierung endlich vorankommen – statt weiter ausgebremst zu werden.
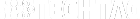



![Rückblick 2025: KI-Alltag, Green Skills und digitale Plattformstrategien [Teil 4] Rückblick 2025](https://techtag.de/wp-content/uploads/2016/12/Jahresrueckblick-Digitalwirtschaft-Teil-4-218x150.png)