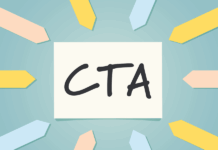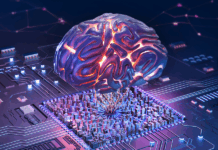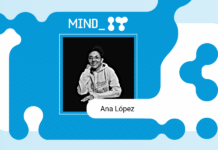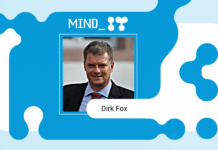Von Oliver Langewitz
Geschichtenerzählen ist eine der hervorstechendsten Eigenschaften der Menschheit. Ob als wesentlicher Bestandteil der Erinnerungskultur oder einfach nur zur Unterhaltung: wir lieben es, uns in fremde Welten zu flüchten, den Abenteuern eines Helden zu folgen – erfreulicherweise heutzutage auch immer häufiger denen einer Heldin – und mitzufiebern, ob es ihnen gelingt, den Sieg über die dunklen Mächte zu erlangen. Ob sich das Liebespaar am Ende auch tatsächlich kriegt. Ob der Mörder gefasst wird oder der Underdog den Boxkampf gegen den Champion gewinnt.
Dabei sind nahezu alle Geschichten bereits erzählt worden, wie uns ein Großteil der Fach-Literatur über das Geschichten erzählen verrät. Das heißt, dass heutige Narrationen nur Variationen dessen darstellen, was schon auf vielfältige Weise zuvor in die Welt getragen wurde. Gefragt sind heute also insbesondere Fähigkeiten wie Kreativität, das Talent zur Modifikation und dramaturgisches Geschick, vermeintlich Neues zu schaffen. Dies grenzte Geschichtenerzählende, im Filmsystem insbesondere verkörpert durch die Drehbuchautor:innen und Regisseur:innen, immer schon von der breiten Masse ab.
Und dann kam die KI ins Spiel. Ich erinnere mich noch gut daran, als ich vor in etwa fünf Jahren das erste Mal mit einer Text-KI in Kontakt geriet. Mein Fokus lag hier erst einmal nur auf der Erstellung von Marketing- und PR-Texten und ich tat mich anfangs schwer damit, dieses noch relativ neue Tool in meinen Arbeitsalltag zu integrieren. Mich störten die vielen Halluzinationen des Systems und die daraus resultierenden Probleme, qualitativ hochwertige, faktenbasierte Texte zu produzieren.
Dennoch schritt die Entwicklung zahlreicher KI-Tools in den verschiedenen Aufgaben-Bereichen stetig voran, in vielen davon exponentiell. Spätestens, als Chat-GPT das Licht der Welt erblickte, war klar, dass wir in eine neue Phase eintreten, in welcher KI nicht mehr nur eine Spielerei für wenige Eingeweihte ist, sondern plötzlich allen halbwegs technisch versierten Menschen ein starkes Werkzeug zur Seite gestellt wurde, um Texte zu produzieren, oder verschiedenste weitere Aufgaben zu lösen. Und eben auch Bilder oder Filme zu erzeugen.
Die Gefahren, die hier mitschwangen, kamen in der Diskussion schnell aufs Parkett: die Wegrationalisierung von ganzen Berufszweigen, Urheber- und/oder Persönlichkeitsrechtverletzungen (Mit welchen Daten wurde die KI trainiert und was passiert mit meinen eigenen Daten?) oder der Veränderung unseres zwischenmenschlichen Verhaltens durch zwischengeschaltete KI-Bots.
Gerade die Filmbranche schien und scheint besonders betroffen zu sein. Denn finden sich hilfreiche KI-Tools in sämtlichen Produktionsphasen wieder. Neben der schon angesprochenen Nutzung in der Ideenfindung und Drehbucherstellung auch für die Produktionsplanung, für die Bilderzeugung (Bewegtbild, Effekte, Animationen usw.), für die Produktion von Sprache, Musik und Sound-Effekte bis hin zur Postproduktion, darunter Schnitt, Audio-Transkriptionen oder die Verbesserung schlechten Bild- und Audio-Materials usw.
Der Aufschrei in den Verbänden war schnell groß und insbesondere in Hollywood gingen Autor:innen und Schauspieler:innen auf die Straße, forderten vonseiten der Produzent:innen klare Regeln für den Einsatz von KI. Denn wenn auch der Einsatz von KI als sinnvoll erscheint, um zum Beispiel einen Menschen digital altern zu lassen, das Gesicht des Stars auf den Körper eines Stuntmans zu setzen oder den Körper in eine Fantasiewelt zu setzen, so sieht es bei vielen anderen möglichen Einsatzgebieten schon gänzlich anders aus.
Erscheint es legitim, bei Dreharbeiten mit bereits gefilmtem Material weitere Szenen durch die KI zu erzeugen und sich dadurch das Schauspiel-Honorar für weitere Drehtage zu sparen? Und wie sieht es bei Synchronsprecher:innen aus, mit deren Stimme eine Sprach-KI trainiert wird, sodass diese nicht mehr gebucht werden? Oder die Stimme eines Hollywood-Stars wie Robert de Niro künftig mithilfe von KI in allen unterschiedlichen Sprachversionen selbst erklingt? Gerade dieses letzte Beispiel würde anfangs vielleicht noch manche Zuschauer:innen in Deutschland stören, da sie Christian Brückners Stimme gewohnt sind. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis wir uns alle daran gewöhnt haben, das Original zu hören. Und insgesamt müssen dann entsprechende neue Vergütungsmodelle her, welche die Leistung der an der Produktion beteiligten Menschen trotz KI entsprechend entlohnen.
Dass sich das Rezeptionsverhalten der Menschen ändert, ist nicht neu. In einer medial überfluteten Gesellschaft haben wir uns hier ein entsprechend breites Spektrum erarbeitet, immer komplexere Inhalte – zum Teil sogar parallel am Second Screen – wahrzunehmen und zu verarbeiten. Und so verändert sich auch stetig unsere Wahrnehmung auf Inhalte und ihre Botschaften, bzw. passt sich diesen an. Wie schon Marshall McLuhan feststellte: „The Medium is the Message!“ Und hier komme ich auf das Thema Qualität und Authentizität.
Es war vor vier Semestern in einer meiner Web-Video-Vorlesungen an einer Karlsruher Hochschule, als ich mit Studierenden über die mangelnde Qualität vieler Videos auf YouTube und TikTok zu sprechen kam. Dabei war die einhellige Meinung der Studierenden, dass ihnen die schlechte Qualität der Videos gar nicht mehr auffallen würde bzw. diese ihnen sogar egal wäre. Dies ließ mich erkennen, wie sehr sich doch das Konsumverhalten in der heutigen Medienwelt durch die Bilderflut verändert hatte. War es doch eigentlich immer Ziel der professionell produzierenden Filmschaffenden, immer höchste Qualität zu erzeugen. Und nun standen da künftige Digital Creators vor mir, bei welchen dieser Anspruch in weiten Teilen fehlte.
Am Störendsten bei mit KI generierten Filminhalten empfinde ich, wie künstlich und mit wie wenig Emotionen diese zumindest heute noch oftmals daherkommen, wie glatt viele Bilderwelten hier gestaltet werden und wie hölzern KI-generierte Sprache klingt. Von fehlerhaften und mangelnden Konsistenzen innerhalb von Narrationen ganz zu Schweigen. Das Unbehagen, das hier bei Rezipient:innen entsteht, ist gemeinhin als Uncanny Valley-Effekt bekannt. Doch was wir heute vielleicht noch weitestgehend als problematisch empfinden, wird sich vermutlich schon in naher Zukunft gelöst haben.
Entweder gewöhnen wir uns daran, ändern also unser Rezeptionsverhalten dahingehend, dass wir über die Zerstörung von Emotionen immer stärker hinwegsehen oder sich die KI-Tools deutlich verbessern werden, solche zu reproduzieren. Vermutlich wird es eine Mischung sein. Und rein KI-generierte Inhalte werden sich zu einem neuen Genre entwickeln, bei welchem diese Abbildungen eine entsprechende Besonderheit darstellen. Eines sollte uns dabei immer klar sein: auch dann wird es noch immer darum gehen, das menschliche Publikum anzusprechen, zu begeistern und zu unterhalten.
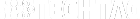



![Rückblick 2025: KI-Alltag, Green Skills und digitale Plattformstrategien [Teil 4] Rückblick 2025](https://techtag.de/wp-content/uploads/2016/12/Jahresrueckblick-Digitalwirtschaft-Teil-4-218x150.png)